Der Wecker klingelt, doch statt des üblichen morgendlichen Trubels herrscht eine drückende Stille. Das Kind liegt im Bett, die Decke bis zum Kinn gezogen, und auf die Frage „Ist alles in Ordnung?“ kommt nur ein leises „Ich kann heute nicht in die Schule“. Was als gelegentliches Bauchweh oder Kopfschmerz beginnt, kann sich schnell zu einem täglichen Kampf entwickeln, der eine ganze Familie an ihre Grenzen bringt. Wenn ein Kind nicht mehr in die Schule will, stehen Eltern oft vor einem Rätsel aus Hilflosigkeit, Sorge und Frustration.
Dieses Phänomen hat einen Namen: Schulabsentismus. Oder etwas weniger modern: Schulverweigerung.
Es ist weit mehr als einfaches „Schwänzen“. Es ist ein stiller (oder sehr lauter) Hilferuf, ein Symptom für tiefgreifende Probleme, die unter der Oberfläche brodeln. In diesem Beitrag tauchen wir tief in die Welt des Schulabsentismus ein. Wir beleuchten, was genau dahintersteckt, warum Kinder den Schulbesuch verweigern, wie es den Betroffenen – Kindern und Eltern – dabei ergeht und, am wichtigsten, welche Wege aus dieser belastenden Situation führen.
Schulabsentismus ist ein wachsendes Thema, insbesondere bei den besonders aktiven, sensiblen und begabten Kindern, die häufig mit besonderen Herausforderungen im Schulalltag konfrontiert sind. Diese Kinder, zu denen auch solche mit Autismus, Hochsensibilität, ADHS, Hochbegabung, Dyskalkulie oder Dyslexie gehören, erleben oft Reizüberflutung und Schwierigkeiten, sich den sozialen Erwartungen anzupassen. Eine starre Herangehensweise, die Kinder zwingt, sich dem Schulbesuch anzupassen, kann kontraproduktiv sein. Vielmehr sind individuelle Lösungen gefragt, die die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder berücksichtigen und unterstützen. Dies beinhaltet die Schaffung von Rückzugsräumen und die Bereitstellung von autonomen Lernmöglichkeiten.
Eine wertschätzende Beziehung zu Lehrpersonen spielt eine entscheidende Rolle. Wenn Lehrer empathisch und unterstützend agieren, fördert das eine positive Lernatmosphäre und hilft Eltern bei der Begleitung ihres Kindes. Als Beraterin und Coach für Eltern neurodivergenter Kinder kenne ich die komplexen Bedürfnisse, die hier gefragt sind. Eine enge Zusammenarbeit mit Schulen, Therapeuten und Eltern kann helfen, ein Umfeld zu schaffen, das Neurodivergenz nicht nur akzeptiert, sondern als Vielfalt zelebriert.
Was Schulabsentismus wirklich bedeutet
Wenn wir von Schulabsentismus oder Schulverweigerung sprechen, meinen wir nicht den Schüler, der einmalig den Unterricht ausfallen lässt, um das schöne Wetter zu geniessen, also zu schwänzen um etwas Cooleres zu machen.
Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Verhaltensmuster, bei dem Kinder und Jugendliche über einen längeren Zeitraum hinweg den Schulbesuch ganz oder teilweise verweigern. Dieses Verhalten ist oft mit erheblichem emotionalem Leid für das Kind verbunden und stellt ein ernstzunehmendes Warnsignal dar, das Eltern und Pädagogen unbedingt beachten sollten.
Es ist entscheidend zu verstehen, dass hinter diesem Verhalten keine Faulheit oder böse Absicht steckt, sondern eine Not. Besonders bei neurodivergenten Kindern kann das Fernbleiben der Schule Ausdruck davon sein, dass sie nicht klarkommen mit dem Schulaltag und sich nicht anders zu helfen wissen. Neurodivergent bedeutet, dass ein Kind Reize, Gefühle und soziale Situationen auf eine eigene Weise erlebt und verarbeitet. Diese Kinder sind häufig besonders sensibel für Lärm, Unruhe, Erwartungen oder soziale Spannungen. Der Schulalltag kann für sie sehr anstrengend oder sogar belastend sein.
Was wie ein „nicht wollen“ aussieht, ist oft ein „nicht können“. Viele Kinder geraten durch die täglichen Anforderungen in starken inneren Stress. Sie entwickeln Ängste, Rückzugsverhalten oder körperliche Symptome. Schulabsentismus kann ein Signal dafür sein, dass ein Kind an seine Grenzen kommt und Schutz braucht.
Es lohnt sich, hinter das Verhalten zu schauen. Wenn wir verstehen, was das Kind wirklich braucht, können wir neue Wege finden. Wege, die sicherer, machbarer und passender für seine individuelle Art zu leben und zu lernen sind.
Eine individuelle Lösung bedeutet, dass man nicht nach einheitlichem Schema vorgibt, wie das Problem gelöst werden muss. Stattdessen wird auf die persönlichen Bedürfnisse und Besonderheiten des jeweiligen Kindes geachtet. Besonders bei neurodivergenten Kindern brauchen wir ganz eigene Wege, die auf ihre Stärken, Vorlieben und Herausforderungen eingehen.
In diesem Artikel
Relevanz des Themas aus der Sicht einer Beraterin und Coach für Eltern neurodivergenter Kinder
Aus Beraterinnensicht zeigt sich, dass Schulabsentismus bei neurodivergenten Kindern häufig missverstanden wird. Viele Eltern fühlen sich hilflos, wenn ihr Kind nicht mehr zur Schule möchte oder kann. In der Beratungsarbeit sehen wir, dass konventionelle Lösungen selten helfen und oft sogar zu mehr Stress führen.
Für Eltern ist es enorm wichtig, das Verhalten ihres Kindes zu verstehen und gemeinsam mit Schule und anderen Fachkräften einen individuellen Weg zu schaffen. Ziel ist es nicht, das Kind einfach zur Schule zu zwingen, sondern zu überprüfen, welche Unterstützung wirklich hilfreich ist. Neurodivergente Kinder profitieren von einem sicheren, verständnisvollen Umfeld und passgenauen Lösungen. Das Thema ist auch gesellschaftlich bedeutend, denn jedes Kind soll das Recht auf Bildung und Wohlbefinden haben. Ein guter Start ist oft, sich als Eltern offen über alle Fachstellen zu informieren und Unterstützung anzunehmen. Denn zusammen gelingt es leichter, individuelle Lösungen für die ganze Familie zu finden.
Wenn du in der Begleitung deines Kindes Unterstützung für dich hinzuziehen möchtest, damit du dein Kind bestmöglich unterstützen kannst, dann melde dich sehr gerne bei mir unter goni@mamaleicht.ch
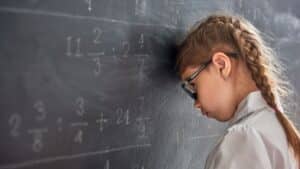
Verschiedene Arten der Verweigerung von Schule
Experten teilen das Phänomen grob in drei Kategorien ein (weiterführend dazu die Texte von Stephan Kälin). Zuerst gibt es die Schulangst oder Schulphobie, die oft als schulvermeidendes Verhalten bezeichnet wird. Hierbei leidet das Kind unter massiven Ängsten, die direkt mit dem Schulbesuch verknüpft sind. Diese Ängste äussern sich häufig durch psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Herzrasen, die auf mysteriöse Weise verschwinden, sobald der Druck, zur Schule zu gehen, nachlässt.
Im Gegensatz dazu steht das Schulschwänzen. Hierbei fehlen die Schüler aktiv und meist ohne Wissen der Eltern dem Unterricht, oft um ihre Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen. Die Gründe sind hier seltener Angst, sondern eher mangelndes Interesse an der Schule, Langeweile oder oppositionelles Verhalten.
Schliesslich gibt es noch das von den Eltern geduldete oder sogar geförderte Fernbleiben, bei dem die Eltern ihr Kind aus verschiedenen Gründen, die nicht immer medizinischer Natur sind, zu Hause behalten. Dies kann beispielsweise wegen weltanschaulichen oder religiösen Überzeugungen, Überprotektion oder Parentifizierung der Fall sein.
Neurodivergente Kinder und Schulverweigerung
Bei neurodivergenten Kindern (z. B. mit Autismus, ADHS, Dyslexie, Dyskalkulie, Hochbegabung, Dyspraxie, Tourette-Syndrom oder Hochsensibilität – also Kinder bei denen das Gehirn anders verdrahtet ist, als es dem gesellschaftlichen Standard entspricht) fallen wohl die meisten Schulabsentisten in die erste Kategorie. Die Ursachen sind hier häufig sensorische Überlastung, strukturelle Unvereinbarkeiten oder unerkannte Über-/Unterforderung statt klassischer Schulangst.
Aktuelle Forschung zeigt: Bei bis zu 30 % der Kinder mit Autismus oder ADHS haben Erfahrungen mit Schulverweigerung gesammelt. Die Gründe unterscheiden sich deutlich von denen neurotypischer Kinder:
- Autismus: Sensorische Überlastung, Pathological Demand Avoidance (PDA), Mobbing.
- ADHS: Unfähigkeit, stundenlang stillzusitzen, chronische Überforderung durch Strukturzwänge.
- Dyslexie/Dyskalkulie: Scham und Angst vor Blossstellung (z. B. Vorlesen, Mathe-Tests).
- Hochsensibilität: Reizüberflutung (Lärm, Licht) führt zu (körperlichen) Stressreaktionen.
- Hochbegabung: Unterforderung oder soziale Isolation („Ich passe nicht hierher“).
Die Wurzeln der Verweigerung – Warum ein Kind nicht in die Schule will
Dass ein Kind sich nicht mehr imstande fühlt, die Schule zu besuchen, ist meist keine Sache, die über Nacht entsteht. Sie ist vielmehr das Ergebnis eines schleichenden Prozesses und eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Faktoren. Die Gründe sind so individuell wie die Kinder selbst, lassen sich aber oft in zwei Hauptbereiche einteilen: schulbezogene und persönlichkeits- bzw. familienbezogene Ursachen. Wobei es in den meisten Fällen ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren ist. Ein genaues Hinsehen ist hier der erste und wichtigste Schritt, um dem Kind wirklich helfen zu können.
Schulische Auslöser
Für einige Kinder wird die Schule, ein Ort des Lernens und der Gemeinschaft, zu einer Quelle von Stress und Angst. Einer der häufigsten und verheerendsten Gründe ist Mobbing. Systematisches Ausgrenzen, Verspotten, körperliche Angriffe oder Cybermobbing, das auch nach Schulschluss nicht aufhört, schaffen ein Klima der ständigen Bedrohung. Das Kind fühlt sich unsicher und schutzlos, und die Verweigerung des Schulbesuchs wird zu einer Überlebensstrategie. Ebenso kann ein enormer Leistungsdruck zu massivem Stress führen. Die ständige Angst vor schlechten Noten, die Furcht, den Erwartungen von Eltern und Lehrern nicht gerecht zu werden, oder das Gefühl, im Vergleich zu Mitschülern zu versagen, kann lähmende Versagensängste auslösen. Sowohl Überforderung durch zu schwere Aufgaben als auch Unterforderung, bei der sich hochbegabte Kinder permanent langweilen und den Sinn des Schulbesuchs infrage stellen, können dazu führen, dass ein Kind nicht in die Schule will. Darüber hinaus kann auch eine gestörte Beziehung zu Lehrkräften oder der Mangel an sozialen Kontakten und Freunden im Klassenverband das Gefühl der Isolation und des Fremdseins verstärken.
Persönliche und familiäre Gründe
Oft liegen die Wurzeln des Problems jedoch tiefer, im persönlichen Erleben des Kindes oder im familiären Umfeld. Psychische Erkrankungen wie Angststörungen (insbesondere soziale Phobien oder Trennungsangst bei jüngeren Kindern), Depressionen oder Traumafolgestörungen spielen eine zentrale Rolle beim Schulabsentismus. Ein Kind mit einer sozialen Phobie fürchtet sich panisch vor Bewertungssituationen, wie dem Sprechen vor der Klasse oder sogar dem Essen in der Kantine. Depressive Stimmungen rauben die Energie und Motivation, die für den Schulalltag notwendig sind. Zudem können auch kritische Lebensereignisse innerhalb der Familie als Auslöser wirken. Eine Scheidung der Eltern, schwere Krankheiten in der Familie, finanzielle Sorgen oder der Tod eines geliebten Menschen können das Sicherheitsgefühl eines Kindes so stark erschüttern, dass es die schützende Umgebung des Zuhauses nicht mehr verlassen möchte. In solchen Fällen ist die Schule nicht das primäre Problem, sondern der Schulbesuch wird zu einer unüberwindbaren Hürde, weil die gesamte Kraft für die Bewältigung der familiären Krise aufgebraucht wird.
Im Auge des Sturms – Das Erleben von Kind und Eltern
Schulabsentismus ist nicht nur ein organisatorisches Problem, sondern eine tiefgreifende emotionale Krise, die das Leben aller Beteiligten auf den Kopf stellt. Um die Dynamik zu verstehen und Mitgefühl zu entwickeln, ist es unerlässlich, einen Blick auf die Gefühlswelten des Kindes und seiner Eltern zu werfen. Beide Seiten befinden sich in einem Strudel aus negativen Emotionen, der sie voneinander entfernen oder, im besten Fall, zusammenschweissen kann.
Für ein Kind, das die Schule verweigert, können die eigenen vier Wände zwei Dinge zugleich sein:
- Ein sicherer Hafen, in dem es endlich Ruhe, Sicherheit und Akzeptanz findet.
- Ein Ort der Isolation, an dem die Schulpflicht wie ein Damoklesschwert hängt und die Rückkehr immer unmöglicher erscheint.
Morgens dominiert die Angst vor Prüfungen, vor Mobbing, vor dem Gefühl, nicht dazuzugehören oder von Über- und Unterforderung. Die Entscheidung, zu Hause zu bleiben, bringt sofortige Erleichterung: Der Druck fällt ab, das Kind atmet auf. Doch diese Erleichterung kommt mit einem Preis:
- Je länger das Kind fehlt, desto mehr Druck baut sich auf; von Seiten der Schule, der Eltern, der Gesellschaft.
- Das Kind muss jeden Tag wieder neu für sich einstehen und dafür, dass es sich nicht vorstellen kann hinzugehen.
- Lernrückstände und soziale Isolation verstärken das Gefühl, „nicht mehr mitzukommen“.
- Scham („Warum schaff ich es nicht, dabei können es die anderen doch auch“) und Wut („Niemand versteht mich“) wachsen.
Das Kind ist zuhause nicht «krank», sondern fühlt sich wie sich selbst, ist ausgeglichen und kreativ. Doch das Umfeld reagiert und sieht vielleicht nur das Fernbleiben, statt der Hintergründe.
Für Eltern, deren Kind die Schule verweigert, ist der Alltag ein emotionaler und organisatorischer Kraftakt:
- Am Anfang stehen Unglaube („Das wird schon wieder“) und Verzweiflung („Warum schafft mein Kind das nicht?“).
- Schnell folgt das Gefühl der Ohnmacht:
- «Haben wir etwas falsch gemacht? Wie hätten wir reagieren sollen?»
- «Warum ändert sich an der Schule nichts?»
- «Wie soll es denn jetzt weitergehen»
Die Belastung wird durch äusseren Druck verstärkt:
- Schule: Anrufe, Schuldzuschiebungen, Drohungen mit Polizei, Behörden oder Psychiatrie.
- Gesellschaft: Scham („Was denken die anderen über uns?“)
- System: Fehlende Ressourcen (z. B. lange Wartezeiten für Abklärungen) und bürokratische Hürden verzögern Unterstützung und Ursachenklärung.
Praktische Herausforderungen:
- Das Kind ist zuhause und muss je nach Alter betreut werden
- Diagnose-Odysseen: Bis Ursachen erkannt werden, können Monate vergehen.
- Finanzielle Belastung: Therapien oder Nachhilfe sind teuer und schwer zu organisieren.
- Es wird von den Eltern erwartet, dass das Kind unter allen Umständen zur Schule befördert wird, was für die Eltern nicht umsetzbar ist.
Die Eltern bräuchten hingegen Verständnis für Ihre Situation und die Situation ihres Kindes, niederschwellige Hilfe, Ursachenklärung und praktische Lösungen, wie dem Kind die Rückkehr ermöglicht werden kann.
Wege aus der Krise: Was Eltern tun können
Erste Hilfe: Kommunikation & Kooperation
Mit dem Kind:
- Verständnis zeigen: „Ich sehe, dass es für dich gerade ganz schwierig ist. Wir finden gemeinsam Lösungen.“
- Fragen stellen (ohne Verhör):
- „Was macht dir in der Schule gerade am meisten Stress?“
- „Würde es helfen, wenn wir mit der Lehrperson über [Rückzugsmöglichkeiten/Anpassungen] sprechen?“
- Validieren, nicht drängen: „Es ist okay, wenn du überfordert bist. Wir schauen, wie wir das ändern können.“
Mit der Schule:
- Frühzeitig Kontakt aufnehmen: Schon bei 3 Fehltagen in 6 Wochen („3/6-Regel“).
- Lösungsorientiert sprechen, Vorwürfe vermeiden, berichten wie es dem Kind geht:
- „Unser Kind hat gerade grosse Schwierigkeiten. Wie können wir es unterstützen?“
- Falls das Kind konkrete Ideen hat, wie es den Alltag in der Schule besser bewältigen könnte, diese Ideen an die Schule weitertragen, ohne fordernd zu sein.
- Schule als Partnerin sehen, nicht als Gegnerin.
Generell: Dokumentieren (z. B. E-Mails, Arztberichte, Verhalten und Aussagen des Kindes und der Schule) für spätere Gespräche.
Professionelle Unterstützung: Das Netz, das trägt
Erste Anlaufstellen:
- Kinderarzt/Kinderärztin: Körperliche Ursachen ausschliessen.
- Schulpsychologischer Dienst
- Lokale Fachstellen, Erziehungsberatung
- Kinder- und Jugendpsychotherapie bei Ängsten oder Traumata.
- Fachpersonen zu der speziellen Herausforderung oder Neurodivergenz des Kindes hinzuziehen.
Wichtig:
- Keine Angst vor Diagnostik: Sie kann helfen, passende Unterstützung zu bekommen.
- Sich Unterstützung zu holen ist sinnvoll und hilft allen Beteiligten, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke, dass ihr wirklich etwas verändern möchtet.
Der Weg zurück in die Schule: Schritt für Schritt
Phase 1: Vorbereitung
- Kleine Ziele setzen: „Heute gehen wir nur für eine Stunde in die Schule und schauen, wie es läuft.“
- Vertraute Begleitung organisieren (z. B. Elternteil, Schulsozialarbeiter:in).
- Schule vorbereiten:
- Lehrpersonen informieren („Unser Kind kommt heute nur für eine Stunde.“).
- „Buddy-System“ vereinbaren (z. B. eine vertraute Mitschülerin oder ein Mitschüler begleitet das Kind).
Phase 2: Langsame Steigerung
- Lieblingsfach zuerst
- Pausen einplanen
- Erfolge feiern
Phase 3: Vollständige Rückkehr
- Schrittweise den Stundenplan erhöhen
- Rückzugsmöglichkeiten sicherstellen
- Regelmässige Reflexion

Wenns nicht klappt: Alternativen erkunden
- Kann die Klasse gewechselt werden
- Gibt es Angebote zur Überbrückung
- Gibt es andere Schulen oder Sonderschulen, welche in Frage kämen
- Ich bin grundsätzlich nicht begeistert, wenn die Eltern die Verantwortung für die Bildung ihrer Kinder übernehmen, wenn keine anderen Lösungen gefunden werden können. Dennoch ist für viele Eltern dies die einzige Möglichkeit, um ihr Kind zu unterstützen:
- Privatschulen anschauen und Optionen erkunden.
- Gibt es die Möglichkeit für eine private Schulung zuhause?
- Gibt es passende Online Schulen?
Selbstfürsorge für Eltern: Du bist nicht allein
- Eigene Grenzen akzeptieren: Du kannst dein Kind nur unterstützen, wenn du selbst (mehr oder weniger) stabil bist.
- Hilfe annehmen (z. B. Grosseltern, Freund:innen, Nachbar:innen).
- Austausch mit anderen Eltern
- Sich selbst Unterstützung suchen, um die Situation besser tragen zu können und das Kind bestmöglich zu unterstützen: Weg von Schuld und Scham, hin zu Stärke, um für das Kind einzustehen und das Kind auch stärken zu können. Diese Unterstützung kann beispielsweise ein Coaching, eine Beratung oder ein Mentaltraining sein – oder alles kombiniert, so wie ich es anbiete. Melde dich sehr gerne unter goni@mamaleicht.ch wenn du dir Unterstützung und Verständnis wünschst.
Rechtliche Schritte
Eltern oder Schule können rechtliche Schritte einleiten, wenn sonst nichts zu einer Lösung führt oder eine Seite nicht mitmacht / nicht einsichtig ist.
Beispielsweise:
- Wenn die Schule nicht kooperiert (z. B. keine Anpassungen trotz nachgewiesener Herausforderungen des Kindes).
- Bei Kindswohlgefährdung (z. B. Vernachlässigung, Missbrauch).
- Wenn das Kind trotz aller Bemühungen nicht zur Schule geht können auch Behörden hinzugezogen werden für eine Beratung und Unterstützung aller in der Situation.
Viele Eltern erleben, dass Ihnen mit rechtlichen Schritten, einer Meldung an die Behörden oder das Rufen der Polizei gedroht wird. Lasst euch nicht verrückt machen! Hier spricht die Überforderung der entsprechenden Person. Auch wenn die Behörden hinzugezogen werden, machen diese nicht einfach irgendetwas, was nicht im Sinne des Kindes ist. Umso wichtiger ist es, dass ihr dokumentiert, wie die Situation entstand und was weiter passiert ist.
Quellen und weiterführende Ressourcen zum Thema Schulabsentismus, insbesondere auch mit Blick auf Neurodivergenzen
Pro Juventute: Ratgeber für Eltern
„Schulverweigerung: Was tun, wenn das Kind nicht in die Schule will?“
- kostenlose Beratung für Eltern, die sofortige Hilfe brauchen, Handlungsempfehlungen, 24/7-Helpline.
Leitfaden Schulabsentismus (2025) von Stephan Kälin
PDF-Download: „Früherkennung und Intervention“
- Praktische Strategien für Eltern die sich tiefer über das Thema informieren wollen und für Schulen und Fachpersonen
Spezifische Ressourcen für Neurodivergenz
- ADHS: Schulabsentismus bei ADHS
- Autismus: Schulabsentismus bei Autismus
- Hochbegabung: Schulverweigerung bei Hochbegabung
- Hochsensibilität: Erfahrungsbericht zum Schulabsentismus bei einem hochsensiblen Kind
Artikel Fritz&Fränzi Magazin: Wenn die Schule zur Qual wird

Goni Boller ist Mentorin und Coach für Mütter, die einen gelasseneren und klareren Umgang mit ihren bedürfnisstarken und vielseitigen Kindern finden möchten. Sie unterstützt Eltern dabei, herausfordernde Situationen besser zu meistern, mehr Ruhe und Sicherheit im Familienalltag zu gewinnen und die Bedürfnisse aller Familienmitglieder im Blick zu behalten. Mit ihrem Wissen aus Hirnforschung, Neurodiversität, Psychologie und der kindlichen Entwicklung begleitet sie Mütter auf ihrem individuellen Weg, ein achtsames und stärkendes Familienleben zu gestalten.
Gemeinsam finden wir die passenden Stellschrauben für dich und deine Familie, für eine Elternschaft, die zu dir passt. Und plötzlich geht alles viel leichter.



